Vermutlich war es so um das Jahr 2004, dass ich meine erste Ablaufbeschreibung im Rahmen meiner Diplomarbeit erstellt habe. Seitdem habe ich vermutlich weit über 500 Prozessdokumentation erstellt, von rein schriftlichen bis hin zu Prozessmodellen oder irgendwelchen Mischformen.
Zwei Sachen erlebe ich von damals bis heute immer wieder:
- Niemand hat wirklich Bock darauf, Prozesse zu dokumentieren
- Selten werden Prozessdokumente wirklich genutzt.
Über die Jahre habe ich gemerkt, dass hierfür vor allem 3 Punkte ausschlaggebend sind.
Grund 1: Die Dokumente sind zu lang
OK, es ist ja durchaus wichtig, dass Prozessdokumente verschiedenen formalen Anforderungen genügen müssen und somit immer irgendwo auch Ballast mit sich schleppen. Ob Gültigkeitsbereich, Änderungsverzeichnis oder ein Glossar, sowas gehört eben der Vollständigkeit dazu, kann aber auch leicht übersprungen werden.
Mir geht es viel mehr darum, dass die Dokumente weitaus mehr Themen und Informationen enthalten, als die meisten Mitarbeiter brauchen:
- Jemand, der nur Bestellanforderungen anlegt, der braucht nicht die Infos, wie eine Bestellung angelegt, freigegeben oder nachgehalten wird.
- Jemand, der eine Anfrage erfasst, den interessieren die verschiedenen Kalkulationsmodelle nicht.
- Wer einen Urlaubsantrag einreichen will, den interessieren die Abläufe für eine Krankmeldung recht wenig.
Tipp:
Es ist wichtig, in z.B. Prozess-Übersichten die Zusammenhänge für alle klar und verständlich zu machen. Wenn es aber um die Dokumentation der operativen Tätigkeiten geht, ist zu empfehlen, diese so kurz und abgegrenzt wie möglich zu gestalten.
Grund 2: Die Dokumente sind zu kompliziert
Wir selbst plädieren dafür, Prozesse auch zu visualisieren. Das schafft Verständnis und so lassen sich hervorragend die Tätigkeiten, eine logische Reihenfolge und das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Teams darstellen. Das reicht meistens für >80% der Prozessdokumentation.
„Modellierungssprachen“, wie die EPK (ereignisgesteuerte Prozesskette) oder der Standard BPMN 2.0 mit seinen über 220 Modellierungssymbolen bieten weitaus mehr. Oftmals erleben wir, dass diese Modelle Auswüchse annehmen, die einfach nicht mehr überschaubar sind. Viele ähneln dem Pariser Metroplan. Das ist nicht einfach und verständlich.
Ebenso ist es mit rein schriftlicher Dokumentation. Dort bietet die deutsche Sprache mit ihrer vielfältigen Semantik und Interpretationsmöglichkeiten oft mehr Fehlerpotential als Nutzen. Was dem einen sehr einfach und verständlich, das mag dem anderen in Buch mit sieben Siegeln sein.
Dies & andere Gründe führen dazu, dass die Dokumente vielleicht gelesen, aber nicht wirklich verstanden werden. Und somit in der Schreibtisch-Schublade langen, und mit vielen weiteren ungenutzten Dokumenten verstauben.
Tipp:
Nutzen Sie einfache Prozessmodelle, um die Zusammenhänge darzustellen. Darauf basierend können Sie weitere Details ergänzen. Wir empfehlen immer, so wenig „Prosa“ wie möglich zu schreiben. Oftmals sind tabellarische Darstellungen eine wunderbare Ergänzung, weil dort alle wichtigen Prozessinformationen und Details einfach & übersichtlich dargestellt werden können.
Grund 3: Die Dokumente enthalten nicht das, was man zum Arbeiten braucht
Von der Analyse bis zur Optimierung: es gibt viele Gründe, Prozesse zu dokumentieren. Oftmals ist aber der Hauptgrund: man will festhalten, wie gearbeitet werden soll.
Jetzt besteht ein Prozess auf vielen verschiedenen Bestandteilen, wie der eigentlichen Tätigkeit (dem was) sowie den dazugehörigen Informationen:
- Input: Welche Informationen, Daten, Dateien / Dokumente benötige ich, um die Aufgaben auszuführen
- Output: welches Ergebnis soll erzeugt werden. Wo wird das Ergebnis abgelegt, gespeichert, dokumentiert
- In welchen Systemen wird ggfs. gearbeitet
- Welche weiteren Hilfsmittel stehen mir zur Verfügung
All diese Informationen stehen oft in sehr langen & unübersichtlichen Dokumenten (siehe Grund 1 & 2).
Und nun kommt der Trugschluss, den offenbar viele nicht wahr haben wollen: NEIN, kein Mitarbeiter arbeitet nach diesen Dokumenten. Selbst wenn diese kurz und verständlich wären, NIEMAND braucht diese Anleitungen. Weil Mitarbeiter in der Regel sehr schnell und gut verstehen, was die verschiedenen Arbeitsschritte sind. Jeder weiß:
- ich muss zuerst ein Angebot anlegen
- dann muss ich die Daten eingeben
- dann muss ich es meinem Vorgesetzen zur Freigabe schicken
Was oft gebraucht wird, um das Arbeiten zu vereinfachen und Fehler zu reduzieren, sind die zusätzlichen Details zu diesen Aufgaben:
- eine kurze Beschreibung, wie das Angebot im System erstellt wird
- eine Checkliste: welche Dateien muss ich im Angebot eingeben. Wo finde ich diese Informationen
- eine einfache Freigabematrix, die den Weg von Freigaben und Entscheidungen darstellt
Genau solche, runtergebrochenen Informationen sind für die Mitarbeiter wichtig. Genau solche Dokumente werden auch ausgedruckt und auf dem Schreibtisch platziert. Als Denkstütze zum Beispiel, oder als Richtschnur.
Tipp:
Wenn Sie den Standard für Ihre Prozessdokumentation festlegen, ist es besonders wichtig, dass sie die Prozesse ganzheitlich und vollständig darstellen. Aber worauf es wirklich ankommt: prüfen Sie genau, welche „Details“ die Mitarbeiter brauchen, um regelmäßig gut und einfach arbeiten zu können. Was macht das Leben wirklich einfacher. Dort sollten Sie den Fokus hinlegen!
Fazit
Ob es die Lust darauf steigert, Prozesse zu dokumentieren? Das weiß ich nicht. Aber wenn Prozesse erstmal gelebt werden, damit Effektivität & Effizienz steigert, es weniger Fehler & Missverständnisse gibt und auch das Arbeiten besser und angenehmer wird. Nun ja, dann bekommt vielleicht dieses elendige Thema einen ganz neuen Stellenwert
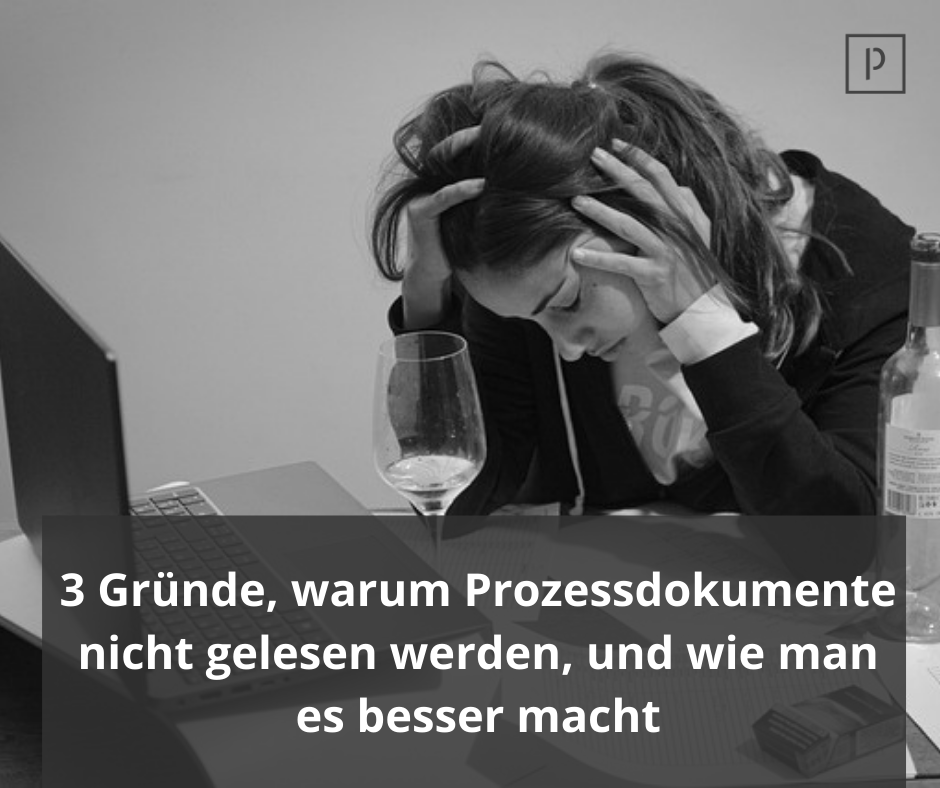
Lieber Bernd Ruffing
Diese Erfahrung und auch die Tipps, wie man es besser machen kann, kann ich nur bestätigen. Schöner Blog-Beitrag!
Ein weiterer Grund, der mir immer wieder auffällt: Es wird mit viel Elan eine Initiative gestartet, Dokumente zu dokumentieren, weil man „an der Stelle noch schlecht aufgestellt ist“. Was nicht thematisiert wird: Was will man mit der Prozessdokumentation erreichen und für wen wird sie gemacht? Es wird direkt in Grundsatzdiskussionen eingestiegen, ob BPMN oder EPK besser ist und welches Tool man einsetzen soll.
Will ich einen Prozess in einer Workflow-Engine automatisieren, ist ein BPMN-Modell mit zig Symbolen und Verzweigungen der richtige Weg. Das Modell wird in dem Fall aber in erster Linie für die Workflow-Engine geschrieben. Erst dann kommen die Menschen, die das Modell verstehen müssen. Bei einem solchen Modell kommt es darauf an, dass alle Details und Sonderfälle präzise erfasst sind.
Will ich mit einer Prozessdokumentation jedoch Wissen vermitteln, damit Menschen besser zusammenarbeiten und gemeinsam komplexe Zusammenarbeit planen oder verbessern, dann brauche ich eine ganz andere Prozessdokumentation.
Ich persönlich habe wie ihr die Erfahrung gemacht, dass man mit einer guten Kombination aus Visualisierung und Text am verständlichsten Wissen vermitteln kann. Zusammenhänge lassen sich meist grafisch gut darstellen. Wobei ein Text kurz durch die Grafik führen sollte. So wie man die Grafik im Gespräch kurz erklären würde. Details oder einfache Abläufe können oft auch leichter textuell beschrieben werden und sollten nicht zwanghaft in Grafiken gezwängt werden, bloß weil Grafiken so chic sind.
Was ganz wichtig ist, was oft vergessen wird: Wer soll die Prozessdokumentation lesen und damit arbeiten? Das hat wesentlichen Einfluss darauf, wie man diese am besten gestaltet. Sind das Menschen, die viel in Excel-Tabellen denken und mit Grafiken wenig anfangen können? Sind das Menschen, die nicht gerne Texte lesen? Welches Grundwissen haben dieses usw.
Wenn Ziel und Zielgruppe einer Prozessdokumentation nicht klar sind, kann man auch keine gute Prozessdokumentation machen. Wobei ich denke, dass die „3 Gründe, warum Prozessdokumente nicht genutzt werden, und wie man es besser macht“ in 90% der Fälle passen.
Viele Grüße ins schöne Saarland, Andreas Bungert