Iterative Prozessentwicklung – Die Aufgaben für Prozessverantwortliche
Die Digitalisierung von Prozessen ist kein einmaliger Kraftakt, sondern ein lernender, iterativer Weg. Wer heute Prozesse automatisiert, muss nicht nur technische, sondern auch organisatorische Anforderungen in Einklang bringen. Und dabei eine zentrale Rolle im Blick behalten: die der fachlichen Projektleitung, meist in der Funktion der Prozessverantwortlichen.
Dieser Beitrag erläutert, wie sich Prozessmodelle im Rahmen der prozessgesteuerten Digitalisierung über mehrere Iterationen hinweg entwickeln – und welche Aufgaben die Prozessverantwortlichen in den jeweiligen Stufen wahrgenommen bekommen.
Digitalisierung beginnt mit einem Perspektivwechsel
Traditionelle Digitalisierungsansätze richten sich oft nach dem, was Standardsoftware bereits kann. Prozesse werden dann so gestaltet, dass sie zur vorhandenen Software passen – nicht umgekehrt. Das Ergebnis: hohe Anpassungskosten, unübersichtliche Workarounds und eine Prozesslandschaft, die weder transparent noch anschlussfähig ist.
Der prozessgesteuerte Ansatz stellt diese Logik auf den Kopf. Nicht die IT bestimmt den Prozess, sondern der Prozess bestimmt, was die IT leisten muss. Die Modellierung erfolgt mit standardisierten Sprachen wie BPMN, die Umsetzung über Process Engines, die keine individuelle Programmierung benötigen.
Doch ein solcher Wandel funktioniert nicht im ersten Wurf. Er braucht ein iteratives Vorgehen – mit klaren Etappen und einer fachlichen Projektleitung, die diese Etappen verantwortet und steuert.
Fünf Prozessmodelle, ein Zyklus
In einem solchen Szenario machen Begriffe wie „Ist-“ und „Soll-Prozess“ keinen Sinn mehr. Stattdessen folgt die prozessgesteuerte Digitalisierung einem Modell mit fünf Prozessstufen. Jede dieser Stufen bringt eigene Aufgaben mit sich.
- Das aktuell verbindliches Prozessmodell
Dieses Modell beschreibt den tatsächlich gelebten Prozess – dokumentiert und umgesetzt in den verwendeten Systemen, Formularen und Kommunikationsmitteln.
Die Aufgabe der Prozessverantwortlichen besteht darin, diesen Prozess im Alltag zu unterstützen, Abweichungen zu dokumentieren, auftretende Fehler zu analysieren und gemeinsam mit den Beteiligten praktikable Workarounds zu entwickeln. Prozesskennzahlen helfen bei der Beobachtung – sie sollten direkt aus den Systemen generiert werden, nicht über manuell gepflegte Excel-Dateien.
- Zielprozessmodell
Das Zielmodell formuliert den angestrebten Zustand. Es geht dabei nicht um eine Idealvorstellung, sondern um ein tragfähiges Zielbild, das mittelfristig realisierbar ist.
Hier ist die Prozessverantwortung gefordert, Anforderungen aufzunehmen, Zielbilder abzustimmen und Prioritäten zu setzen. Die Vermittlung zwischen unterschiedlichen Interessenlagen der Prozessbeteiligten, der IT und der Führung ist dabei ebenso entscheidend wie die Fähigkeit, ein konsistentes und kommunizierbares Zielbild zu formulieren.
- Nächstes realisiertes Prozessmodell (technisch in Arbeit)
Dieses Modell beschreibt die nächste konkrete Ausbaustufe, die in der nächsten Iteration umgesetzt wird. An dieser Iteration ist inhaltlich nichts zu ändern, die technischen Veränderungen sind schon „in der Mache“. Also Finger weg und die Techies in Ruhe arbeiten lassen.
Prozessverantwortliche können zum einen schon mit dem Training und der Dokumentation für die Prozessbeteiligten starten, denn Umfang, Inhalt und Zeitpunkt der Änderungen sind bereits fix. Außerdem müssen sie parat stehen, wenn aus der technischen Realisierung fachliche Rückfragen kommen. Die Entwickler haben nicht die Zeit, lange auf die Beantwortung von Rückfragen zu warten. Hier ist Entscheiden gefragt, nicht Rückversichern.
- Übernächstes Modell (in Planung)
In der nächsten Iteration wird immer nur soviel umgesetzt, wie technisch auch schaffbar ist. Die technisch verantwortlichen bestimmen das Tempo. Denn nichts ist schlimmer, als Funktionen zu versprechen, die man dann doch nicht umgesetzt bekommt. Darum gibt es nach der nächsten Iteration immer eine übernächste.
Die ist auch noch nicht konkret in Arbeit, also kann man über Umfang und Inhalt der Prozessänderungen noch streiten. Und das soll man auch tun.
Aufgabe für die Prozessverantwortlichen ist es, diese Diskussion zu moderieren und zu einem fachlich klar definierten Prozess zu bringen. Am Ende dieser Iteration muss das Prozessmodell für die technische Umsetzung wasserdicht sein, sonst können die Entwickler das nicht umsetzen. Hier ist also die BPMN-Kenntnis der Prozessverantwortlichen gefragt.
- Weitere Iterationen
Da auch nach der übernächsten Iteration in der Regel noch nicht Schluss ist, gibt es immer eine „Warteliste“ mit Prozessverbesserungen, die zwar gewollt sind, aber noch nicht konkret in der Planung. Diese Änderungen müssen fachlich diskutiert werden. Manche Idee stellt sich dann als nicht sinnvoll heraus und wird verworfen.
Hier haben die Prozessverantwortlichen die Aufgabe, einerseits neues Denken abseits der ausgetretenen Pfade zu ermöglichen und andererseits, die Ideen irgendwann in einen Rahmen von „sinnvoll“, „wirtschaftlich machbar“ und „technisch machbar“ zu bringen.
Fachliche Projektleitung: Mehr als Koordination
Die Rolle der fachlichen Projektleitung in der prozessgesteuerten Digitalisierung geht weit über klassische Koordinationsaufgaben hinaus. Sie ähnelt in vielerlei Hinsicht der Rolle eines Product Owners in der agilen Softwareentwicklung – mit einem entscheidenden Unterschied: Während der Product Owner vor allem für das Produkt steht, steht die Prozessverantwortung für den Gesamtablauf – mit allen Auswirkungen auf Organisation, Zusammenarbeit und Ergebnisqualität.
Fachliche Projektleitung bedeutet hier, Verantwortung zu übernehmen: für das Ergebnis, für den Weg dorthin, für den Dialog mit allen Beteiligten. Es geht darum, Anforderungen zu priorisieren, Entscheidungen herbeizuführen und Konflikte nicht zu scheuen, sondern zu klären.
Iteration verlangt Haltung – und Reflexion
Der iterative Weg ist nicht der bequemste. Er verlangt Geduld, Aufmerksamkeit und Mut zur Unvollständigkeit. Es geht nicht darum, sofort die perfekte Lösung zu liefern, sondern mit jeder Iteration dazuzulernen und die Organisation mitzunehmen.
Gerade in komplexen Prozessen zeigt sich oft erst nach der Einführung einer neuen Version, wo es noch hakt. Wer diese Rückmeldungen aufnimmt und in die nächste Iteration überführt, sichert nicht nur die Qualität des Prozesses – sondern stärkt auch die Akzeptanz in der Organisation.
Neugierig: Hier gibt es mehr zur prozessgesteuerten Digitalisierung
Dieser Beitrag stammt aus meinem Buch Systemisches Prozessmanagement – Unternehmen digitalisieren, Teams mobilisieren. (Schäffer-Poeschel, 2. Auflage 2025).
👉 Hier kostenfreie Leseprobe anfordern
Zum Autor:
Rainer Feldbrügge ist systemischer Organisationsberater mit Schwerpunkt Geschäftsprozessoptimierung und Führung. Er arbeitet an der Schnittstelle zwischen Führungskompetenz, Prozessdesign und IT-Umsetzung im Rahmen der prozessgesteuerten Digitalisierung. Er lehrt Organisation, Prozessmanagement und Lean Management an der Hochschule für angewandtes Management und ist Autor des Buchs „Systemisches Prozessmanagement“.
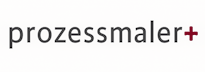






0 Kommentare